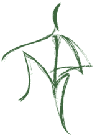Mut zur Muße in einer unvollkommen Welt
Oder: Selber denken macht frei
Ein Artikel von Sylvia Wetzel, in Connection Special: Der neue Mensch. Oktober-November 2003, S. 18-21
Wer sich Gedanken über die Zukunft macht, weiß, daß diese Welt nicht vollkommen ist. Wer weiß, daß die Welt unvollkommen bleiben wird und darüber nicht verzweifelt, macht das beste aus dem, was geschieht und fördert das beste in sich und in den anderen. Welche Bedingungen braucht es dazu? Welche Fähigkeiten brauchen die Menschen im einundzwanzigsten Jahrhundert, um Mut zum Leben in einer unvollkommen Welt zu entwickeln? Wir brauchen vor allem zwei Fähigkeiten. Wir müssen lernen, selber zu denken und tragfähige Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen und zu halten. Diese beiden Fähigkeiten wurden in der griechischen Antike geschult und geschätzt, und das Mittelalter nannte die entsprechenden Lebensstile vita contemplativa und vita activa. Der folgende Beitrag will Mut zur Muße, zur vita contemplativa machen, zum Selberdenken anstiften und zur meditativen Schau dessen, was ist. Und er möchte an die griechische Bedeutung der vita activa anknüpfen, die auch heute noch hochaktuell ist. Die Griechen unterschieden drei Arten von Tätigsein: Arbeiten zum Lebensunterhalt ist notwendig, und das künstlerische und handwerkliche Herstellen und organisatorische Erhalten der gemeinsamen Welt ist nützlich. Als eigentlichen Sinn des aktiven Lebens definierten die Griechen Politik, und zwar im Sinne von „Sprechen und Handeln im öffentlichen Raum“, mit dem Ziel tragfähige Beziehungen unter Menschen zu stiften, die ein Interesse „an der gemeinsamen Welt“ verbindet. (Hannah Arendt)
Wenn wir uns Gedanken über uns und die Welt machen, kreisen unsere Überlegungen um vier Fragekomplexe: Wo stehe ich heute? Woher komme ich? Wohin will ich? Was halte ich für möglich? Was wir praktisch tun, hängt davon ab, wie wir diese Fragen beantworten. Woran denke wir, wenn wir unser Leben betrachten? Was macht mir Freude? Was inspiriert mich? Wovor habe ich Angst? Worüber mache ich mir Sorgen? Welche Rolle spielen nahe Beziehungen: die „Liebesbeziehung“, Freundinnen und Freunde und Angehörige, öffentliche Kontakte im Beruf, in der Gemeinde und im politischen Raum; Menschen, mit denen wir zusammen wohnen und arbeiten, Sport treiben und über die Lage in der Welt diskutieren, meditieren und ausgehen, Freizeit und Hobbies teilen? Wie wichtig ist für uns Geldverdienen, berufliche und ehrenamtliche Arbeit? Welche Rolle spielen Politik im Sinne des „Sprechens und Handelns im öffentlichen Raum“, und die Wertschätzung und Pflege von Kunst und Kultur? Genießen wir Kultur mit anderen oder eher allein? Mit wem teilen wir unser Interesse an der gemeinsamen Welt, in der wir leben? Wie war das in Kindheit und Jugend? Welche Lebensformen und -modelle kenne ich? Was wünsche ich mir für die Zukunft, für den „Rest meines Lebens, das heute beginnt“ (Ayya Khema)?
Das zwanzigste Jahrhundert hat den Menschen in Europa ein Wechselbad von Lebensformen, politischen Systemen, Leitbildern und Idealen beschert. Das geschah in einem Tempo, das uns kaum Zeit gelassen hat, die vielen neuen Elemente unseres Lebens zu verdauen. Die Krise der Moderne und der Postmoderne ist eine Krise der Menschen, deren Lebensbedingungen sich viel zu schnell verändern. Die traditionellen Beziehungsgefüge haben sich gelockert, und für viele Menschen sind sie zerbrochen und tragen nicht mehr. Wer lebt noch in der Blutsfamilie oder am Ort der Geburt? Wer hat noch enge Beziehungen zur Kirche der Kindheit? Wer lebt noch in der gleichen sozialen Schicht wie die Eltern? Wer arbeitet noch im erlernten Beruf oder gar im gleichen Betrieb wie Mitte zwanzig? Wir können kurz an die fünf bis zehn nächsten Menschen denken, mit denen wir derzeit viel zu tun haben. Wie lange kennen wir diese Menschen schon? Wie lange begleiten sie unser Leben? Was geben sie uns? Was geben wir ihnen?
Beziehungsgefüge sind unverzichtbar für unsere innere und äußere Entwicklung zu Menschen, und sie haben dabei mindestens zwei Funktionen: Sie geben Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung, und sie engen den Handlungsspielraum ihrer Mitglieder ein. Weil wir uns nach Freiheit sehnen, haben wir uns aus traditionellen Beziehungsnetzen gelöst. Aber auch Freiheit hat zwei Seiten. Wenn wir „frei“ sind, können wir denken, tun und lassen, was wir wollen, und wir genießen das. „Anything goes“ ist das Motto der Zeit. Viele Menschen fühlen sich aber auch einsam und verloren, nicht mehr geborgen in einer Welt, die kaum noch verbindliche Feste, Bräuche und Sitten, Lebensmodelle, Ideale und Ziele hat. Daß das Gewebe der „Tradition mit dem Fortschreiten der Moderne immer fadenscheinige r geworden ist, ist für niemand ein Geheimnis.“ (Arendt) Es war schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts „fadenscheinig“ geworden, und der Faschismus und der Stalinismus zeigten im europäischen Raum, daß er völlig gerissen war. Innerlich haltlose Menschen haben diese Bewegungen gestiftet und getragen. Von beiden Bewegungen hat sich die europäische Menschheit befreit, und unterschiedliche Varianten einer posttotalitären Gesellschaft entwickelt. Aber überall auf der Welt, wo Menschen kulturell und sozial haltlos leben, gibt es Neigungen zu totalitären Modellen. Wie im Supermarkt, gibt es im politischen und kulturellen, im philosophischen und religiösen Bereich heutzutage eine Fülle von Ansichten und Meinungen, mit denen Menschen Orientierung für ihr Leben finden wollen. Es gibt individuelle und kollektive, politische und spirituelle Visionen einer neuen Welt. Wie soll man sich da zurecht finden?
Wenn der Faden der Tradition abreißt, wirkt sich das auf alle Bereiche des Lebens aus: auf Beziehungen und Arbeitsverhältnisse, auf Politik und Kultur, auf Religion und Geschlechterrollen. Manche Menschen versuchen den gerissenen Faden der Tradition wieder zu knüpfen. Sie wenden sich alten Modellen zu und trinken und verkaufen „alten Wein in neuen Schläuchen“. Eine Spielart dessen sind fundamentalistische Ansätze in den etablierten Religionen. Die politische Variante ist eine Absage an die Demokratie und die Dominanz ökonomischer und militärischer Fakten. Diese Menschen glauben an das Zurück zu einer idealisierten guten alten Zeit, und sie predigen das, und manche kämpfen dafür. Aber man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, genauso wenig wie alte Menschen wieder Kinder werden können. Was tun, wenn wir nicht zurück können, aber auch nicht genau wissen, wohin der Weg führt? Wir können versuchen, uns „in der Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft“ (Arendt, Übungen,18) bewegen zu lernen. Und diese Bewegung in der Lücke ist das selbständige Denken. Man kann es nicht wirklich lehren, aber man kann es lernen, in dem man es tut und mit anderen darüber spricht.
Zwei Fähigkeiten sind es also, die Menschen ohne traditionelle Bindungen Mut machen können zum Leben in einer unvollkommen Welt: Muße zum Nachdenken und die Pflege von privaten und öffentlichen Beziehungen. Beides gilt heutzutage nicht viel. „Zeit ist Geld“ heißt es, und Beziehungen „kosten“ Zeit.
These zur Muße
Wer über sich und die Welt nachdenken will, braucht Zeit. Wer keine Zeit hat, wird immer nur alte Ansichten, emotionale Muster und Gewohnheiten reproduzieren.
Wer nachdenken will braucht nicht nur Freizeit nach der Arbeit, um sich zu regenerieren, sondern Muße. Muße ist freie Zeit, in der wir wach und ausgeschlafen, frisch und munter sind. Dann können wir über uns und die Welt nachdenken. Wer im Laufschritt durch die Welt rennt, hat keine Chance eigene Muster zu erkennen. Wer zu wenig Zeit, wird sich auch mit erprobten Meditationstechniken nicht besser kennenlernen. Wer unter Druck steht und keine Zeit hat, kann und wird immer nur alte Ansichten, emotionale Muster und Gewohnheiten reproduzieren. Wir sind nicht in der Lage, die sozialen und kulturellen, wirtschaftlichen und menschlichen Probleme unserer Zeit zu lösen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, sie sorgfältig anzuschauen. Damit man ein Problem lösen kann, muß man aber wissen, was nicht funktioniert. Um zu verstehen, was nicht funktioniert, muß man sich Beziehungen und Arbeitsverhältnisse, Umwelt und politische Strukturen, emotionale Muster und eigene Ansichten genau anschauen. Wir haben auch deshalb keine Zeit zum Hinschauen und Nachdenken, weil das mühsam und manchmal verstörend ist und als unproduktiv gilt.
Die Neuzeit trat mit dem Wunsch an, den Menschen das Leben zu erleichtern, ihnen mehr Freiheit und Wohlstand zu bringen. Aber sie idealisiert nun Arbeit, setzt Leistung als höchsten Wert (Zeit ist Geld) und lehnt ein kontemplatives Leben als parasitär ab. Nachdenken und Meditieren gelten nur dann als akzeptabel, wenn sie schnelle Lösungen bringen: verwertbares und umsetzbares Wissen über die äußere und innere Welt. Im Bereich der Meditation sucht man also wirksame Meditationstechniken, die Konzentration und Entspannung, Körperbeherrschung, Beweglichkeit, angenehme Gefühle und besondere Erfahrungen bescheren. Wer sich enttäuscht von einer „schlechten“ Welt abwendet und den Rückzug in eine ideale innere und private Welt predigt, entfremden sich aber nur noch mehr von sich selbst, seinen Mitmenschen und der Welt. Rückzug aus der Welt ist immer nur Mittel und nicht Selbstzweck. Er ist dann sinnvoll, wenn die gemeinsame Welt nicht ignoriert wird und unser Herz sich für sie öffnet und der Geist klarer wird.
Es ist nicht leicht, in diesen arbeitssüchtigen Zeiten den Mut zur Muße zu finden. Es wird einfacher, wenn wir begreifen, daß ohne Muße alles beim Alten bleibt oder nur noch schlimmer wird. „Wer keine Zeit hat, hat keine Seele.“ (Jean Gebser), „Je weniger Sinn wir im Leben sehen, desto schneller eilen wir.“ (Viktor Frankl). Veränderungen sind ohne Muße nicht möglich. Das müßten eigentlich alle wissen, die Auto fahren: Wer umschalten will, muß zuerst in Leerlauf schalten.
Buddhistische Meditation kann der Einstieg zu einem Leben der Muße sein, und für mich war stille Sitzmeditation die erste legitime Form des Nichtstuns. Meditation lehrt aber nur dann Muße, wenn wir uns nicht mit komplexen Techniken um schnelle Resultate bemühen, sondern sie uns den Freiraum schenkt, in dem wir innehalten und unsere eingefahrenen Muster anschauen. Es braucht aber mehr als zehn Minuten stilles Sitzen am Tag. Kontemplativ leben, heißt Raum und Zeit schaffen, damit wir über unsere Prioritäten nachdenken und unsere Beziehung zu uns, den Mitmenschen und der Welt klären können. Der Faden der Tradition ist gerissen. Mann kann ihn nicht wieder knüpfen. Man muß auf eigenen Füßen stehen lernen und anfangen selber zu denken. Nachdenken kann man nur alleine und in Muße. Wenn unser Denken aber nur um uns selbst kreist, führt das schnell zu Verzweiflung und Einsamkeit. Damit das „Denken ohne Geländer“ (Arendt) unser Herz öffnet und den Geist klärt, brauchen wir das Gespräch mit anderen Menschen und den Bezug zur gemeinsamen Welt.
These zu Beziehungen
Wir brauchen tragfähige Beziehungen zu anderen Menschen, wie die Luft zum Atmen.
Wir brauchen andere Menschen, mit denen wir über unsere gemeinsame Welt sprechen können, denn die Wirklichkeit unserer Welt wird nur durch die Gegenwart anderer Menschen garantiert. Ein Wirklichkeitsgefühl entsteht für Menschen nur im Miteinander leben und sprechen, „dort…, wo eine und dieselbe Welt in verschiedensten Perspektiven erscheint.“ (Arendt, Vita, 250-51) Wenn wir mit anderen sprechen, achten wir eher auf das Außen und fühlen und ganzheitlicher und vollständiger. Je einsamer Menschen leben, desto unwirklicher fühlen sie sich, denn sie verstricken sich leicht in Selbstzweifel. Umso schwerer fällt es ihnen dann, sich mit anderen zu verständigen. Wir können uns leichter auf andere Menschen einlassen, wenn wir verstehen, daß wir tragfähige Beziehungen zu anderen Menschen brauchen, wie die Luft zum Atmen. Wir müssen unsere Mitmenschen nicht lieben, es reicht, wenn wir sie achten. Wir brauchen Menschen „im Plural“, also Menschen, die unterschiedlich sind und denen wir uns zugehörig fühlen. Dazu müssen wir sie persönliche kennen und Zeit und Raum, Interessen und Lebensbedingungen, Feste und Rituale und das Interesse und die Freude über die gemeinsame Welt teilen
Wir brauchen Phasen des Alleinseins und das Zusammensein mit anderen, weil wir beides sind: Individuen und soziale Wesen. Als Individuen sehnen wir uns nach Freiheit und als soziale Wesen nach Geborgenheit. Wir können nur dann Vertrauen fassen in die innere Weisheit, die innere Gutheit – Buddha-Natur, das Göttliche in uns, das höhere Selbst -, und uns damit verbunden fühlen, wenn diese größere Dimension in uns auch durch eine Gruppe im Außen gespiegelt wird, der wir uns zugehörig fühlen. Und erst wenn wir diese Dimension der inneren Gutheit in uns verläßlich spüren, können wir sie auch in anderen erkennen.
Zur Autorin
Sylvia Wetzel, Jahrgang 1949, Abitur 1968, befaßt sich seit Ende der sechziger Jahre mit psychologischen und politischen Wegen zur Befreiung und seit 1977 mit Buddhismus, vor allem der tibetischen Tradition. Seit 1980 bewegt sie sich in der deutschsprachigen buddhistischen „Szene“, als Mitgründerin und langjährige Vorsitzende eines buddhistischen Zentrums mit angeschlossenem Buchverlag, als Übersetzerin und Kursassistentin, als „Funktionärin“ im buddhistischen Dachverband Deutsche Buddhistische Union, als Redakteurin der Lotusblätter und seit Ende der achtziger Jahre als buddhistische Meditationslehrerin, Vortragende und Autorin. Mit ihren kulturkritischen und feministischen Ansätzen ist sie eine Pionierin des Buddhismus in Europa.
Zum Weiterlesen
Hannah Arendt, Menschen in finsteren Zeiten. (1968) München Piper 1995/2001
Hannah Arendt, Vita Activa oder vom tätigen Leben. (1958) München Piper 1971/2001
Hannah Arendt, Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Übungen im politischen Denken I. (1968) München Piper 1994/2000
Sylvia Wetzel, Das Herz des Lotos. Frauen und Buddhismus. 208 S. Frankfurt Fischer 1999.
Sylvia Wetzel, Hoch wie der Himmel. Tief wie die Erde. Praktische Meditationen über Liebe, Beziehungen und Arbeit. 208 S. Berlin Theseus 1999.
Sylvia Wetzel Leichter leben. Praktische Meditationen zum Umgang mit Gefühlen. 224 S. Berlin Theseus 2002.