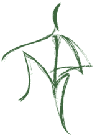Ausführliche Biografie
Schwarz, Rot, Grün – Ein Schwarzwaldmädel, rote Roben und die Grüne Tara
Diese ausführliche Biografie von Sylvia Wetzel erschien im Sammelband des O.W. Barth-Verlags „Mein Weg zum Buddhismus. Deutsche Buddhisten erzählen ihre Geschichte“, Frankfurt 2003, herausgegeben von Dagmar Doku Waskönig. Sie darf hier freundlicherweise publiziert werden. Danke!
Der Start ins Leben
Vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ich im Herzen des Schwarzwaldes geboren, wuchs als Tochter und Enkelin einer „Adlerwirtin“ hinter dem Tresen eines badischen Gasthofs auf, besuchte nebenbei die Schule und machte im denkwürdigen Jahr 1968 das Abitur. Die Nähe zur Schweiz, zum Elsass und Sommergäste aus Frankreich, England und den USA brachten die große weite Welt in unser Haus und nährten die Sehnsucht nach der Ferne. Zu den Sternstunden jener Zeit gehören die Alemannische Fastnacht, endlose Sommer in unserem großen Gemüse- und Obstgarten, die Maiandachten mit den hochdramatischen Mariengesängen, Ferienlager und Wanderungen mit den Pfadfinderinnen und die große Bibliothek meiner Großmutter und Mutter. Voller Neugier auf das „richtige“ Leben ließ ich 1968 den „kleinbürgerlichen Mief“ und die äußere und innere Enge der Schwarzwaldtäler hinter mir und stürzte mich Hals über Kopf in das Leben als Studentin in Heidelberg. Im Gepäck hatte ich eine solide Allgemeinbildung und erste Erfahrungen in angewandter Demokratie und Pressefreiheit als Klassensprecherin und Redakteurin der Schülerzeitung.
Sehnsucht nach einer besseren Welt
Aus Liebe zur slawischen Seele und zur russischen Literatur studierte ich Slawistik und aus der Sehnsucht nach einer besseren Welt Politologie. In vollen Zügen genoß ich das bunte politische Leben an den Universitäten Heidelberg und Berlin in der Aufbruchstimmung der sechziger und siebziger Jahre. Wir streikten für bessere Studienbedingungen und demonstrierten gegen den Vietnamkrieg, setzten uns ein für die Öffnung der Psychiatrie und gegen die Erhöhung der Preise im öffentlichen Nahverkehr, gegen die kapitalistische Ausbeutung und für die freie Liebe hier und jetzt. Neben dem Studium betreute ich Schulkinder in einem Heidelberger Obdachlosenviertel, bereitete in Wochenkursen Arbeiterjugendliche und Studentinnen der Sozialarbeit in Berlin auf ein politisch aktives Leben vor und verdiente meinen Lebensunterhalt selbst, zunächst als Kellnerin und später als studentische Hilfskraft an der Institutsbibliothek. Das sorgte für Bodenhaftung und stärkte die Verbundenheit mit dem „einfachen Volk“.
Anfang der Siebziger Jahre verbrachte ich immer wieder einige Wochen mit Sprachkursen in der damaligen Sowjetunion und machte kleine Abstecher ins Baltikum und in die zentralasiatischen Republiken. In Usbekistan streifte mich zum ersten Mal der Atem Asiens. Ein einziges Semester in Leningrad, dem Venedig des Nordens, im Jahre 1974 genügte, und meine letzten Hoffnungen auf das sozialistische Modell russischer Art waren mausetot. Blieb noch eine Hoffnung: China. Kurz vor dem Abschlussexamen für das Lehrfach am Gymnasium besuchte ich im Sommer 1975 die Volksrepublik China. Als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer waren wir vor allem an Erziehungsfragen interessiert. Zwei Wochen redeten deutsche und chinesische PädagogInnen fruchtlos aneinander vorbei, und nach drei Wochen legte ich ein weiteres politisches Ideal zu den Akten. Fast zumindest.
Inzwischen nährte die Frauenbewegung neue Hoffnungen. Meine Arbeit als freiberufliche Deutschlehrerin für Aussiedler aus Polen und dem übrigen Osteuropa ließ mir 1975 bis 1977 genügend freie Zeit, an der neuen Frauenzeitschrift „Courage“ mitzuarbeiten. Gleichzeitig entstand in einem Kreuzberger Keller – dort übten auch die „Flying Lesbians“ – die zweite deutsche Frauenrockband „Lysistrara“, in der ich den Elektrobass spielte. Der Name war inspiriert von der griechischen Lysistrata. Sie hatte den ersten Bettenstreik der Frauen organisiert und die Männer damit ganz schnell vom Kriegführen abgebracht. Bei endlosen Jam-Sessions im Musikkeller erlebte ich „Momente, da gab es keine mehr, die spielte. Die Musik spielte sich von selbst.“ Seltsame Eindrücke, die ich nicht einordnen konnte. Sie jagten mir aber keine Angst ein, sondern inspirierten eher dazu, noch mehr Musik zu machen. Unsere „Geige“ fing damals im Herbst 1976 mit „Zen-Meditation“ an und erzählte von „Sesshins“ und Einzelgesprächen mit dem Meister. Seltsam aber „irgendwie“ spannend.
Kultureller Weltschmerz
Nach der ersten China-Reise von 1975 hatte ich mir geschworen, nicht noch einmal nach Fernost zu reisen, ohne mir Indien anzuschauen. Schon 1975 waren erste Bekannte, Freundinnen und Freunde nach Indien gereist und hatten nach ihrer Rückkehr begeistert von ihrem Guru Rajneesh erzählt. Das Gerede von Gurus und Hingabe brachte zwar keine Saite in mir zum klingen, und ich fand es äußerst lästig, meine alten FreundInnen plötzlich mit Ma Yoga Irgendwie und Swami Soundso anzureden, aber irgend etwas gefiel mir an diesen Indienreisenden. Sie hatten etwas Leichtes und Liebenswürdiges, und sie kämpften nicht mehr voller Wut gegen die ganze Welt.
Von Fritz Perls‘ Gestalttherapie lernten wir in der Zeit, dass die Umwelt „irgendwie“ ein Spiegel unserer selbst sei, und das brachte mich zum Nachdenken: „Wenn diese“, wie ich inzwischen fand, „furchtbare Welt ein Spiegel meiner Seele ist, dann steht es schlecht um mich“. Ich sah mich in einer Welt der Ausbeutung, in der einige wenige Menschen unsinnig konsumierten und den Rest der Welt hungern ließen, in der Frauen als Menschen zweiter Klasse betrachtet und Kinder misshandelt wurden, wo Menschen nur noch für die Arbeit lebten, ohne Freude, ohne Lachen, ohne Zeit. In einer Welt, in der Macht und Geld regierten, und unsere guten Ideen von einer gerechten Welt ohne Krieg von den Mächtigen verlacht wurden. Ich lief durch Berlin und ärgerte mich über Werbung, Filme, Zeitungsberichte, Theaterstücke und Romane und sah nur die Arroganz der Reichen und Mächtigen, Frauenfeindlichkeit und Dummheit. Es schien keine Ideale zu geben, und mein Glaube an einen neuen Gesellschaftsentwurf auf sozialistischer oder feministischer Grundlage hatte bereits tiefe Risse bekommen.
Mein kultureller Weltschmerz verschärfte sich, als ich Anfang 1977 eine relativ feste Stelle als Deutschlehrerin angeboten bekam. Sollte das mein weiteres Leben sein? Sollte ich die nächsten vierzig Jahre Unterrichtseinheiten erstellen, zwei Mal im Jahr Urlaub machen und dem Untergang des Abendlandes taten- und hilflos zusehen? Ich schrieb damals in mein Tagebuch: „Ich möchte endlich für etwas sein, und nicht immer gegen die ganze Welt kämpfen müssen.“ Einen weiteren Anstoß gab ein Science-Fiction-Film im selben Frühjahr: Die Bösen hatten das Trinkwasser von New York vergiftet, und alle Menschen wussten, dass sie innerhalb der nächsten zwei Wochen sterben würden. Ich saß mit einer Freundin in Berlin vor dem Fernseher, und wir fragten uns, was wir wohl tun würden, wenn wir nur noch ein paar Wochen oder Monate zu leben hätten. Die erste Antwort war: „Musik machen, Haschisch rauchen und auf keinen Fall so weiter leben.“
Indien ruft
Von der Schwester einer Freundin erhielt ich damals ein paar Briefe aus Nepal. Sie schwärmte von einem „buddhistischen Kloster im Himalaya, von Meditation und Lamas“. Als sie braungebrannt, entspannt und sanft lächelnd Ende 1976 nach Berlin zurückkam, stand mein Entschluss fest: Nach der zweiten China-Reise würde ich Indien besuchen und nachschauen, was mich diese alte Kultur über das Leben lehren konnte. In dieser Verfassung brach ich nach knapp zwei Jahren Berufstätigkeit als Deutschlehrerin zu meiner zweiten Asienreise auf. Wohlweislich hatte ich eine Nachmieterin für meine Wohnung gefunden, Auto, Stereoanlage und den Großen Brockhaus in zig Bänden verkauft und mich auf ein, zwei Jahre Reisen eingestellt. „Vielleicht bin ich schon in drei Monaten zurück, vielleicht aber auch erst in zwei Jahren.“ war meine Devise. Ich wollte auf alle Fälle den Rücken frei haben für das, was dort möglicherweise auf mich wartete.
Ein Jahr nach dem Sturz der „Viererbande“ reiste ich 1977 wieder nach China. Dieses Mal mit 23 Frauen aus der Berliner und der westdeutschen Frauenszene, um Lage und Ideen der „anderen Hälfte des Himmels“ zu studieren. Wieder besuchten wir Volkskommunen, Fabriken, Krankenhäuser, Kindergärten, Grund-, und Mittelschulen. Wieder redeten wir in den offiziellen Gesprächen aneinander vorbei, und auch die wenigen privaten Gespräche waren fruchtlos. Auch dieses Land war kein Vorbild auf meiner Suche nach einer besseren Welt, schon gar nicht in eine wie auch immer definierte Freiheit als Frau.
In Hongkong verabschiedete ich mich von meiner Frauengruppe und setze mich ins Flugzeug nach Indien. Ein paar Stunden später stand ich mit der Gitarre auf dem Rücken und meiner roten Reistasche in Kalkutta am Flughafen. Vor mir endlos viel Zeit, alleine in einem riesigen Land mit einer der ältesten Hochkulturen im indo-europäischen Raum. Fünf Tage spazierte ich durch Kalkutta, war entsetzt über Armut, Dreck und Chaos, sehr berührt von den Gesichtern und – „fühlte mich seltsam heimisch“. Ich hatte mir bislang nie Gedanken über Seelenwanderung oder Wiedergeburt gemacht, und auch heute beschäftigt mich die Frage nach früheren oder zukünftigen Leben nicht besonders, aber schon in diesen ersten Tagen in Indien fühlte ich mich so „zu Hause“, dass frühere Leben in Indien eine gute Erklärung dafür bieten könnten. Vielleicht erhielt aber einfach meine bis dahin ziemlich verschüttete religiöse Seite die Nahrung, nach der sie sich immer schon gesehnt hatte, ohne darum zu wissen. Möglicherweise brachte auch das Nebeneinander von vergangener Pracht, improvisierter Gegenwart und endlosen Baustellen ein Wissen um Vergänglichkeit ins Bewusstsein, das mich tief aufatmen ließ. Auch wenn die Häuser aus Stein und Brücken aus Stahl in Europa ständig rufen „Ich bin für die Ewigkeit gebaut“, klingt daran etwas falsch, und ich hatte unter dem Anspruch der Beständigkeit gelitten. Alles in Indien schien mir einstimmig zuzurufen: „Die Welt ist unbeständig.“, und das finde ich heute noch bei jedem Besuch Indiens ungeheuer erholsam.
Angekommen mit Widersprüchen
Inzwischen war es Ende Juli 1977, und der Monsun setzte Tag für Tag alles unter Wasser. Ich erinnerte mich an eine Postkarte, die eine Freundin vor einem halben Jahr von einem alten Freund erhalten hatte: „Im Monsun empfehle ich dir Dharamsala. Es ist wunderbar.“ Mit dem Nachtzug ging es von Delhi nach Norden. Unterwegs versuchten mich schöne, gebildete Inderinnen davon zu überzeugen, dass für Touristen Kulu und Manali viel, viel schöner seien. „Ich aber „musste“ nach Dharamsala“. Die vierstündige Busfahrt vom Bahnhof Pathankot nach Dharamsala wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. Es war Vollmond. Als die Sonne aufging, ging der Vollmond gerade unter. Für Minuten sah man beide über den Bergen. „Ein Glücksgefühl erfasste mich, das mich fast zwei Jahre nicht mehr verlassen sollte.“
Im Tourist-Bungalow in Dharamsala, dem Sitz der tibetischen Exil-Regierung und des Dalai Lama, begegnete ich zwei Stunden nach meiner Ankunft am frühen Vormittag einem Australier. Er lud mich zu einer „Party im Tibeter-Ashram“ ein, die am Nachmittag stattfinden sollte. Ich hatte im Flugzeug von Hongkong nach Kalkutta zwar ein Taschenbuch über „den“ Buddhismus gelesen und wusste nicht einmal, dass es so etwas wie „tibetischen“ Buddhismus gibt. „Warum nicht“, dachte ich. Zusammen gingen wir bergauf zu einem tibetischen Studienzentrum, der Library of Tibetan Works and Archives, in der gegen drei Uhr eine traditionelle „Guru-Puja“ stattfand. Kaum sechs Stunden nach meiner Ankunft in Dharamsala saß ich unter tibetisch singenden Frauen und Männern aus dem Westen, auf dem Thron saß ein rotgekleideter Mönch, und an den Wänden hingen bunte brokateingefasste Rollbilder von vielerlei Gottheiten. Dies alles kam mir recht exotisch vor. Irgendwann merkte ich, dass ich leise mitsummte. Einige Melodien erinnerten mich an gregorianische Kirchenmusik und an die schönen Seiten meiner katholischen Kindheit. Zwischendurch wurden Kekse und Obst verteilt und Tee ausgeschenkt, und alle schwatzten beim Essen und Trinken ein wenig. Tief im Herzen wusste ich: „Ich bin angekommen.“
Nach der Puja machten wir uns auf den „Heimweg“ nach Lower Dharamsala. Nach drei Minuten suchten wir Schutz vor einem typischen Monsun-Sturzbach unter dem Vordach eines großen Hauses. Zwei Minuten später kam eine blonde Frau zu uns gestürzt, auch auf der Suche nach Schutz vor dem Regen. Eine Stunde später standen wir immer noch da, jetzt in der Sonne. Cathy war aus Neuseeland und lebte seit einem knappen Jahr hier. Die Journalistin und linke Feministin hatte einige Jahre in London gearbeitet. Sie besorgte uns beiden im Handumdrehen ein Haus in ihrer Nähe und nahm unsere buddhistische Erziehung in die Hand.
In diesen ersten Wochen in „Little Tibet“ fühlte ich mich hin- und hergerissen zwischen einer unsäglichen Freude an den klaren Lehren über Liebe, Mitgefühl und Einsicht und meiner Auflehnung gegen feudale Sitten und patriarchale Strukturen. Acht Wochen nach dem ersten öffentlichen Konzert unserer Frauenrockband in der alten TU-Mensa in Berlin, sechs Wochen nach meiner Abreise aus Berlin, und zwei Wochen nach einer Rundreise durch die Volksrepublik China auf der Suche nach den befreiten Frauen saß ich jeden Tag in einem mittelalterlich wirkenden Tempel. Auf einem Thron saß ein rot gekleideter Mönch und erzählte dreißig Menschen aus dem Westen etwas über die Eigenschaften der Buddhas, über den Wunsch, Erleuchtung zum Wohle aller zu erreichen, über die Weisheit, die Leerheit versteht usw.
Ohne meine erste Lehrerin Cathy, die meine Fragen kannte und verstand, hätte ich den Kulturschock dieser ersten Wochen wohl kaum so gut überstanden. Wir verbrachten drei Monate mit Gesprächen über Gott, Buddha und die Welt, mit gemeinsamen Yoga-Stunden und Parties, spielten Gitarre, sangen Folksongs und tanzten Blues, rauchten selbstangebautes Haschisch und wanderten in den Bergen. Seither weiß ich, wie wichtig es für Menschen aus dem Westen ist, gerade am Anfang des Weges nicht nur bei asiatischen Lehrern zu lernen. Menschen aus der eigenen Kultur können Brücken bauen und sehr viele Anstöße geben, selbst wenn sie noch nicht unendlich tief mit den Lehren vertraut sind.
Der „Mann meines Lebens“
Im Herbst 1977 gingen Cathy und ich im Wald von Upper Dharamsala spazieren und begegneten zwei tibetischen Mönchen. Sie fragten uns nach unseren Plänen. Wir wollten beide zum Novemberkurs ins Kloster Kopan nach Nepal, denn eine Freundin hatte mir vor einem Jahr Loblieder auf dieses Kloster und seine Lamas, auf Berge und Meditation gesungen. Als der stämmigere der beiden Lamas hörte, dass Cathy schon fast ein Jahr in Dharamsala studierte, ich aber erst ein paar Wochen, schlug er ihr vor, in Dharamsala zu bleiben. Zu mir sagte er nur: „Es ist gut, wenn du nach Kopan kommst.“ Die beiden Lamas hießen Thubten Yeshe und Thubten Zopa Rinpoche. Ich war gerade dem Mann begegnet, der mein Leben verändern sollte, wie keiner davor und danach.
Die folgenden beiden Winter verbrachte ich im Kloster Kopan in Nepal. Unter der liebevollen Anleitung von Lama Yeshe, den eher strengen Unterweisungen seines Hauptschülers Lama Zopa und mit der Hilfe vieler westlicher Nonnen, Mönche und Laien lernte ich in Kopan den tibetischen Buddhismus von der Pike auf kennen. Tibetische Lamas hielten Vorträge, westliche Nonnen, Mönche und Laien leiteten Meditationen an, und in Gesprächsgruppen diskutierten wir heftig und hitzig über alle schwierigen Aspekte der Lehren. In kurzen Klausuren meditierten wir über tantrische Gottheiten und lasen Tonbandabschriften mit Kommentaren zu den Übungen.
In Lama Yeshe hatte ich einen Lehrer gefunden, der mir aus dem Herzen sprach. Mit bodenständigen Lehren, unerschöpflichem Interesse am Denken seiner westlichen Schülerinnen und Schüler und viel Humor gab er uns praktische Orientierung im verwirrenden Kosmos des tibetischen Buddhismus. Schon in Süddeutschland hatte ich gelernt, dass man seine Zeit gut nutzen solle. So räumte ich an kursfreien Tagen die umfangreiche Bibliothek westlicher Bücher auf und führte das typisch universitäre Ordnungssystem ein, mit Titelkarten, einer Stichwort- und einer Autorenkartei. Es besteht heute noch und wird meist von Deutschen auf den neusten Stand gebracht. Zwei Winter brachte ich kleinen Mönchen im Kloster in der Mittagspause Englisch bei, ohne Bücher und Tische, mit einer Schiefertafel und etwas Kreide.
Etwas über zwei Jahre lebte ich in Asien. Ich pendelte zwischen dem Kloster Kopan in Nepal und dem tibetischen Studienzentrum in Dharamsala in Nordindien, studierte Buddhismus und vertiefte meine Studien in kürzeren und längeren Meditationsklausuren. Insgesamt ein Jahr hörte ich fünf Mal die Woche Vorträge in Dharamsala, lernte etwas Tibetisch und Sanskrit und verbrachte rund zehn Monate mit intensiven Meditationsklausuren von bis zu zwei Monaten Dauer, anfangs in kleinen Gruppen, später auch alleine. Zwischendurch machte ich kleine Reisen nach Indien: Varanasi, Bodhgaya, Darjeeling, Orissa, Poona, Rishikesh und immer wieder Delhi. Im Herbst 1979 war ich bereit, nach Berlin zurückzukehren.
Von Berlin nach Niederbayern
Zwei Wochen nach meiner Rückkehr im Herbst 1979 unterrichtete ich wieder Deutsch als Fremdsprache für deutschstämmige Aussiedler aus Polen, Rumänien und Rußland und für russische Juden. Ich kam provisorisch in einer Berliner Laube im Grünen unter. Berlin war für mich lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg in ein buddhistisches Zentrum. Ich fühlte ich mich sehr mit Lama Yeshe und dem Kloster Kopan verbunden, überarbeitete Lama Yeshes Vorträge auf Englisch und experimentierte mit ersten deutschen Übersetzungen von Meditionsanweisungen. In den Schulferien besuchte ich die Lama-Yeshe-Zentren in Italien und in England und ein buddhistisches Zentrum in Hamburg und überlegte, wo ich leben wollte. Ich begegnete Menschen, die genau wie ich den tibetischen Buddhismus in Asien kennengelernt hatten und hier in Deutschland weiter üben wollten. Im Herbst 1980 besuchte Lama Yeshe das zweite Mal Deutschland. Zwei Tage nach Kursende reiste ich als frischgebackene Leiterin des neu gegründeten Aryatara Instituts zurück nach Berlin. Im März 1981 packte ich mein Hab und Gut in einen VW-Bus und zog nach Niederbayern.
In sechs Monaten verwandelten sechs Ex-Hippies eine kleine ehemalige bayrische Grundschule in ein funktionsfähiges Seminarhaus. Wir hatten kein Geld, keine Erfahrung in der Leitung eines Zentrums und recht wenig Ahnung von Buddhismus. Begeisterung, praktische Intelligenz, Improvisationsfähigkeit und Mut machten fast alles wieder wett. Lama Yeshe und Lama Zopa weihten das Zentrum im September 1981 mit einem großen Kurs ein, und der Alltag begann. Nach knapp eineinhalb Jahren hatten wir gute Beziehungen zu unseren ländlichen Nachbarinnen und Nachbarn aufgebaut, waren mit eigenen Kursen und Gastkursen relativ ausgelastet, und es gab keine ernsthaften finanziellen Sorgen mehr.
Von Anfang an spielten Frauen ein große Rolle im Zentrum: Schutzpatronin war die Grüne Tara, eine Verkörperung des Klugen Handelns aller Buddhas und als Weisheit ihrer aller Mutter. Eine Kerngruppe von drei Frauen führte das Haus in den ersten Jahren. Wir fühlten uns als Pionierinnen und hatten relativ guten Erfolg mit unserer Mischung aus traditionellen und experimentellen Kursen. Es gab Kurse mit tibetischen Lamas und mit Nonnen, Mönchen und Laien aus dem Westen. Sie wurden ergänzt durch intensive Gruppenklausuren und längeren Meditationsphasen im Winter. Ganz im Sinn von Lama Yeshe und in Absprache mit ihm widmeten wir uns mit großer Energie der Begegnung von Ost und West und boten spezielle Kurse dazu an: Grüne Tara und Mutter Maria (mit einem evangelischen Pfarrer!), Buddhismus und Psychotherapie (mit einem Gestalttherapeuten) Buddhismus und Jung`sche Psychologie (mit einem Religionswissenschaftler und Sandspieltherapeuten), Buddhismus und Politik (mit einer Grünen Kreistagsabgeordneten), befassten uns mit Kulturpsychologie und sozialen Fragen. Wir waren offen für neue Ideen und hielten besonders Ausschau nach Lehrerinnen, aber auch nach Lehrern, die mit neuen Formen und Ansätzen experimentierten. In der Leitung wechselte ich mich mit einer Kollegin im Haus ab. Im Marien-Monat Mai 1987 bot ich den ersten Kurs für Frauen an: „Frauen auf dem Weg“.
Leben als Nonne
Nach acht Jahren Buddhismus und vier Jahren in einem tibetisch-buddhistischen Landzentrum sehnte ich mich nach einer Intensivierung meines geistigen Weges. Ich hatte in Asien gelebt, und jeden Winter meditierten wir bereits zwei Monate gemeinsam mit Gästen, die bereit und fähig zu Einzelklausuren waren. Was gab es noch? Die Tradition bot mir den Weg der Nonne an. Im Frühjahr und Sommer 1985 hatte eine von mir sehr verehrte kanadische Nonne mehrere Monate unser Zentrum besucht und Kurse gegeben. Ich fand sie lebendig, offen und bodenständig. Meine beste Freundin im Zentrum wollte ebenfalls Nonne werden, und so „nahmen“ wir im Sommer 1985, passenderweise an Maria Himmelfahrt (!), „die Roben“. Ich ließ mir die Haare scheren, zog rote Nonnengewänder an und verschwand erst einmal für vier Monate in Klausur.
Endlich musste ich mir keine Gedanken mehr über Kleidung machen, niemand fand es mehr komisch, wenn ich vor allem meditieren und studieren wollte, und niemand überredete mich mehr zu Ausflügen nach München oder ins Umland. Etwas später merkte ich allerdings noch mehr: Niemand nahm mich mehr in die Arme, Gäste und KursteilnehmerInnen stellten mich noch mehr auf ein Podest als zuvor, und ich fühlte mich von anderen Menschen etwas abgeschnitten. Ich wurde immer strenger und ernster, und das gefiel mir gar nicht. Im zweiten Jahr meines Nonnenlebens veränderte sich unser Drei-Nonnen-Haus dann sehr drastisch. Meine beiden Mit-Nonnen „verließen“ mich. Die eine kehrte zurück nach Kanada, um ihre kranken Eltern zu pflegen, und die andere lebte mit ihrem neuen Freund im Zentrum. Meine Motivation fürs Nonnendasein wurde auf eine harte Probe gestellt. Den folgenden Winter reiste ich nach Asien, nahm an der Ersten Internationalen Konferenz über buddhistische Nonnen in Bodhgaya im Februar 1987 teil und suchte händeringend westliche Nonnen, die bei uns im bayrischen Jägerndorf leben wollten. Keine kam mit. Alle hatten bereits eine Aufgabe in anderen Zentren oder wollten in Asien bleiben. Zwei Monate nach meiner Rückkehr stand mein Entschluss fest: „Ich geben meine Roben zurück. Ich trete wieder aus dem Orden aus.“
In den buddhistischen Traditionen kann man den Orden jederzeit wieder verlassen, und wenn man die Gelübde nicht gebrochen hat, kann man auch wieder eintreten. Mein Eindruck war: Für eine Weile tat mir das Leben als Nonne gut. Es spornte mich zur Übung an und gab meinem Leben eine noch klarere Ausrichtung. Doch bald stellte ich fest, dass diese Lebensform nicht meine besten Seiten zum Vorschein bringt, sondern Selbstgerechtigkeit und Enge fördert. Fast ein Jahr versuchte ich, mit meinen Zweifeln zu leben und sie als notwendige Krise einer Anfängerin auf dem Nonnenweg zu interpretieren. Ich war sogar bereit, das Zentrum zu verlassen und das einzige westliche Nonnenkloster meiner Tradition in Frankreich aufzusuchen. Unser Haus-Lama gab mir folgenden Rat: „Das Zentrum ist dein Kind. Wenn du weggehst, ist das Zentrum in Gefahr. Bleibe lieber hier und gib meinetwegen die Roben zurück. Ob du Nonne bis oder nicht, ist nicht so wichtig.“
Zwei Wochen später legte ich in einem kleinen Ritual meine Roben ab und kehrte zurück in den Laienstand. Ich habe keinen Tag bereut, dass ich Nonne gewesen bin. Ich habe eine asketische Seite, und ich habe sie ausgelebt. Aber ich bin froh, dass ich die Roben wieder abgelegt habe, als ich bemerkte, dass viele Regeln für meinen Geist nicht gut sind. Ich werde dann rebellisch oder zu streng. Mit den fünf Laiengelübden lebe ich gerne, und sie inspirieren mich zu einem wachen Leben. Außerdem wurde mir klar, dass ich weder alleine noch im Zölibat leben will. Ich brauche Menschen und auch nahe Beziehungen zu ihnen. Wenn Beziehungen „generell“ ein Hindernis auf „dem“ geistigen Weg sind, dann ist mir ein solcher Weg „zu geistig“. Das ist dann nicht mein Weg. Ich suche einen Weg, den ich gemeinsam mit mir nahen Menschen gehen kann. Einen „Weg mit Herz“, wie Don Juan einst sagte, den ich „mit Leib und Seele“ gehen kann.
Ein weiterer Grund, die Nonnenroben abzulegen war die Einsicht, dass ich nicht als „wandelnde Fahne“ durchs Leben gehen möchte. Ich möchte weder durch bestimmte Kleidung noch durch einen exotischen Namen Menschen auf mich und das, was ich tue, aufmerksam machen. Wenn andere sich in eine asiatische oder westliche Tradition einbinden können und das auch durch Namen und Roben ausdrücken wollen, so achte ich das als eine Möglichkeit, den Weg zu gehen. Es ist nicht mein Weg. Ich schätze den Buddhismus als die bislang größte Inspiration meines Lebens und möchte dabei eine Frau aus dem Westen bleiben, auch in meinem äußeren Auftreten.
Im Westen: Miteinander arbeiten und leben
Ich habe den Buddhismus in der tibetischen Tradition kennengelernt und fühle mich sehr mit ihr verbunden. Nach dem Tod meines Herz-Lehrers Lama Yeshe (1936-1984) sehnte ich mich nach einer Frau, bei der ich weiter lernen konnte. Auf einer Konferenz begegnete ich der deutschen Zen-Meisterin Gesshin Prabhasa Dharma Roshi (1933-1999) und übte acht Jahre lang Rinzai-Zen mit ihr. Fünf Jahre lernte ich bei Ayya Khema (1923-1997) die Theravada-Tradition kennen. Heute studiere ich mit einem englischen Lehrer der Nyingma- und Kagyu-Tradition, Rigdzin Shikpo. Derzeit inspiriert mich besonders die Zusammenarbeit mit westlichen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen buddhistischen Traditionen. Wir bieten zusammen Kurse an, tauschen uns aus und lernen viel voneinander.
Das Leben in einem buddhistischen Zentrum bot mir acht Jahre lang einen Ort, wo ich mit Gleichgesinnten zusammen leben, arbeiten, studieren und üben könnte. Wir hatten viel Raum, immer wieder nach Sinn und Bedeutung von Lehren und Übungen zu fragen. In dieser Atmosphäre fanden die fünfzehn Menschen, mit denen ich im Lauf von acht Jahren zusammenlebte, ihren jeweils eigenen Zugang zum Buddhismus. Trotz aller Aufs und Abs gehören die acht Jahre im Jägerndorfer Landzentrum zu den glücklichsten und inspirierendsten Phasen meines Lebens. Wir organisierten und betreuten Kurse, gründeten 1983 den Diamant Verlag, übersetzen und veröffentlichten Bücher aus der mündlichen tibetischen Tradition vom Englischen ins Deutsche. Ab 1984 arbeitete ich im buddhistischen Dachverband Deutsche Buddhistischen Union mit und seit der Gründung ihrer Zeitschrift Lotusblätter im Jahre 1987 in der Redaktion.. Dadurch kam ich in engen Kontakt mit Übenden und Lehrenden aus anderen buddhistischen Traditionen. Wir sahen einander häufig, bereiteten buddhistische Tagungen mit ReferentInnen aus unterschiedlicher Traditionen vor, versuchten möglichst viele Gemeinschaften zur Mitarbeit zu motivieren. Wir meditierten zusammen, besuchten uns gegenseitig in den Zentren und erlebten ganz hautnah, dass es viele Wege zum Erwachen gibt.
Frauen und Buddhismus, Frauen und Freiheit
Die Begegnung mit dem Buddhismus hatte mein Herz berührt wie nichts zuvor im Leben. Ich fand die tibetischen Lamas klug und voller Wärme. Die Lehren waren zwar scholastisch strukturiert und häufig seltsam und überaus moralisch formuliert, aber klar und inspirierend. Die Übungen funktionierten und öffneten mir die Augen für mich selbst und die anderen. Ich fühlte mich wohl und fand mich wieder in den Lehren. Zumindest solange ich mich als „allgemeinen“ Menschen oder als Individuum sah. Doch trotz allem guten Willen meinerseits war unübersehbar, dass auch im Buddhismus – wie überall – auf allen Ebenen Männer die erste Geige spielten. Die wunderbaren Lehrer waren alle Männer, der Buddha war ein Mann, die Kommentare zu den Lehrreden und heiligen Schriften stammten von Männern, der Dalai Lama war ein Mann usw. Ich fragte mich immer wieder: Wo sind hier die Frauen? Ist das auch ein Weg für Frauen? Eine so wunderbare Lehre kann doch nicht einfach genauso männerfixiert sein wie alle Wege im Westen, die ich kannte. Für eine Weile stellte ich die Frage nach den Frauen zurück, sah mich als Individuum, arbeitete, studierte und meditierte. Doch ich merkte immer deutlicher: Auch im Buddhismus steht hinter dem allgemeinen Menschen, dem die wunderbaren Lehren und Übungen gelehrt wurden, das Modell Mann. Immer lauter wurden meine Fragen nach Rolle und Ort der Frauen.
Die Begegnung mit Übenden und Lehrenden aus anderen buddhistischen Traditionen erleichterte mir das Fragen, da ich ihnen mit mehr Distanz gegenüber stand. Es ist nicht einfach, Menschen zu hinterfragen, von denen man sehr viel gelernt hat und die man schätzt. Es fiel mir leichter, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Theravada, dem Zen und den anderen tibetischen Traditionen über die Rolle der Frauen zu sprechen und ihre Aussagen in Frage zu stellen. Es dämmerte mir, dass der Buddhismus genauso patriarchal war und auch sein musste wie alle anderen Systeme in Gesellschaften, in denen Männer den Ton angeben und Frauen aus vielen Bereichen ausgeschlossen sind. Doch gab es einige feine Unterschiede.
Meine damalige Analyse ergab: Die Lehren selbst sind zu großen Teilen brauchbar für Frauen. Das zeitbedingte Gewand des Buddhismus ist in allen Traditionen recht patriarchal, kann aber verändert werden. Drei Aspekte der Lehren fand ich auf meiner Suche nach dem Ort der Frauen theoretisch und praktisch außerordentlich hilfreich: 1. In der Buddha-Lehre wird der eigenen Erfahrung großer Wert beigemessen, also gibt es prinzipiell auch Raum für die Erfahrungen von Frauen. 2. Es geht darum, Leiden abzubauen. Wenn ich Lamas darauf hinwies, dass frauenfeindliche Aussagen oder bloße Beispiele aus einer mittelalterlichen Männerwelt Frauen verletzen, waren sie sehr bemüht, die nächsten Vorträge anders zu gestalten. 3. Die wichtigste Lehraussage in Sachen Frauen ist für mich die Lehre vom bedingten Entstehen. Wenn man sie klug auslegt, müsste eigentlich auch ein konservativ denkender Lama, Meister oder Schüler begreifen, dass Selbstbilder, Geschlechterrollen, Geschichten und Lehrmethoden zeitbedingt sind und damit veränderbar. Auf diese Lehren greife ich häufig zurück.
In den Begegnungen und Gesprächen mit Frauen und Männern auf dem buddhistischen Weg begriff ich bald, dass es auch hier mehr als eine Generation dauern würde, um Lehren und Übungen von ihren patriarchalen Elementen befreien zu können. Ende der achtziger Jahre fiel mir in der buddhistischen Welt die Rolle der „Feministin vom Dienst“ zu. Dies ist keine leichte Rolle. Sie brachte mich immer wieder in ernsthafte Krisen. Nicht immer war ich guten Mutes, und manchmal verlor ich die Geduld. Die Jahre der Meditation hatten mich zwar gelehrt, dass Veränderungen unendlich langsam vonstatten gehen, aber oft war dies schwer zu ertragen. Im Herbst 1993 saß ich nach einer Redaktionssitzung der Lotusblätter heulend im Auto und verwünschte mein hartnäckiges Suchen nach dem eigenen Weg. Warum konnte ich nicht wie so viele andere Frauen und Männer den vorgegebenen Bahnen folgen und „geschlechtslosen“ Buddhismus üben und lehren? Dieser Zusammenbruch war der Wendepunkt. Danach spürte ich plötzlich mehr Vertrauen dazu, dass mein Weg mich schon dahin bringen würde, wo ich hingehöre.
Zwei Seelen kämpften Ende der achtziger Jahre in meiner Brust: Einerseits leitete ich immer noch ein tibetisch-buddhistisches Zentrum und repräsentierte zunächst als Vizepräsidentin und später als Sprecherin der Deutschen Buddhistischen Union den Buddhismus in der allgemeinen Öffentlichkeit. Andererseits erkannte ich immer genauer, wie sehr auch „der Buddhismus“ und seine Vertreter die Welt mit den Augen der Männer sahen, und wie wenig Frauen, ihre Erfahrungen und ihre Fragen in den allgemeinen Lehren vorkamen. Das tat weh. Besonders schmerzhaft war, dass kaum jemand unter meinen buddhistischen Kolleginnen und Kollegin die Frage nach den Frauen wichtig nahm und niemand das Thema als Problem beider Geschlechter begriff. Wenn ich nicht darauf pochte, war das Thema vom Tisch. Für die anderen war das mein Trip. „Und wenn schon“, dachte ich mir, „es geht um mein Leben, und die Fragen berühren mein Herz.“ Irgendwann hörte ich auf, nach Anerkennung für meine feministische Buddhismus-Kritik zu suchen. Ich suchte nach einem Weg für Frauen, hielt Vorträge zum Thema und gab Meditationskurse für Frauen. Wenn das die anderen nicht interessierte, war das ihr Problem. Überraschenderweise interessierten sich von dem Augenblick an einige Kolleginnen und Kollegen für meinen Ansatz und stellten plötzlich ihre eigenen Fragen.
Ich spürte, dass ich für mein Forschen mehr Raum brauchte. Nachdem ich eine Nachfolgerin eingearbeitet hatte, legte ich Ende 1988 die Leitung des Seminarhauses nieder, blieb dem Zentrum aber weiterhin verbunden und halte auch heute noch Kurse im Münchner Zentrum. Jetzt hatte ich den Raum, den Buddhismus „mit den Augen einer Frau“ gegen den Strich zu bürsten. Die äußere Distanz gab mir ein Umzug nach Frankfurt. Noch war Berlin von einer Mauer umgeben, und ein Leben in einer Stadt ohne grünes Hinterland war für mich undenkbar geworden. Nach zwanzig Jahren Wohngemeinschaft, davon zwölf Jahre in buddhistischen Zentren – mit einem kurzen Berliner Zwischenspiel – zog ich Anfang 1989 mit knapp vierzig Jahren in eine Einzimmerwohnung im Frankfurter Nordend und suchte Arbeit. Wieder unterrichtete ich Deutsch als Fremdsprache. Ich hatte noch in Jägerndorf bereits zwei Bücher für einen „professionellen“ buddhistischen Verlag übersetzt und nahm weitere Aufträge an. Meinen Lebensunterhalt verdiente ich mit Deutschunterricht und Übersetzungen, und meine Arbeit ließ mir genügend Zeit, regelmäßig an Klausuren und buddhistischen Seminaren teilzunehmen und auch selbst zu unterrichten. In der Jägerndorfer Zeit hatte ich viele Kurse als Übersetzerin begleitet, später auch Meditationen und Gesprächsgruppen angeleitet und Vertiefungskurse gegeben. Ab 1986 gab ich vermehrt Kurse in Jägerndorf und wurde eingeladen, auch Meditationskurse an anderen Orten zu geben.
In der Frankfurter Zeit prüfte ich den Buddhismus noch einmal auf Herz und Nieren. Ist das wirklich auch einen Weg für Frauen? Eine große Inspiration war mir dabei die Begegnung mit den Werken der feministischen Psychoanalytikerin Luce Irigaray und der italienischen Philosophin Luisa Muraro. Zusammen mit einer feministischen Philosophin aus Frankfurt begann ich, Kurse zum Thema Geschlechterdifferenz an der Frankfurter Frauenschule zu geben. In einigen Kursen experimentierte ich mit meditativer Textlektüre und stillen Übungen. Aus diesen Kursen entstanden neue Ansätze für Meditationskurse mit Frauen: Wie weibliche Freiheit entsteht; Mutter-Tochter, Göttin-Frau; Neid und Konkurrenz unter Frauen, Übergangsriten für Frauen u.a. Seit 1982 hatte ich in Absprache mit Lama Yeshe Übungstage, Wochenenden und Übungswochen zur Grünen Tara für Menschen ohne „Einweihung“ in die Praxis angeboten. Diese Veranstaltungen stoßen auch heute noch auf großes Interesse, und diese Praxis steht heute im Zentrum meiner buddhistischen Kurse. Schwerpunkt aller meiner Kurse ist die zeitgenössische Interpretation der Lehren. Sie richten sich ausdrücklich auch an Menschen, die weder eine neue Religion suchen noch Interesse an den Feinheiten buddhistischer Philosophie haben. Sie möchten Menschen im Westen Zugang zu den lebensnahen Konzepten und praktischen Übungen des Buddhismus bieten. In allen Kursen werden daher der persönliche Erfahrungshintergrund sowie geschlechtsspezifische und sozio-kulturelle Bedingungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einbezogen. Besonders Frauen genießen es, dass ihre Lebenswirklichkeit – mit Beziehungen, Kindern, Doppelbelastung und Alltag, mit Interesse am Körper, den Sinnen und der Welt – nicht als Hindernis, sondern als Ausgangspunkt ihres spirituellen Weges angenommen und geschätzt wird.
Der Kreis schließt sich: Jütchendorf bei Berlin
Auf der Abiturfahrt nach Berlin hatte ich mich 1968 in diese Stadt verliebt. Knapp zehn Jahre hatte ich dort in der wichtigen Phase zwischen zwanzig und dreißig gelebt. In all den Jahren fern von Berlin fühlte ich mich weiterhin als Berlinerin, kam regelmäßig zu Besuch und gab dort ab 1980 regelmäßig Meditationskurse für Frauen. Im November 1989 fiel die dann die Berliner Mauer. Seit März 1993 lebe ich mit sechs Frauen, zwei kleinen Mädchen, einem Hund und zwei Katzen auf dem Land südlich von Berlin auf einem ehemaligen Bauernhof. Dort verbinden sich zwei Welten: Die anregende Atmosphäre einer Großstadt im Umbruch und die ländliche Ruhe eines märkischen Dorfes. In Berlin sind die Folgen der Wiedervereinigung überall sichtbar und oft schmerzhaft spürbar, und sehr viel Neues ist möglich. Rund dreißig buddhistische Zentren bieten Veranstaltungen an, und die Menschen, die sie leiten, sind in der Regel wach und aufgeschlossen und arbeiten auch gerne traditionsübergreifend zusammen. Ein guter Rahmen und sichtbarer Ausdruck des dichten Netzes von Verbindungen in viele Bereiche – Frauen, Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur – ist für mich die 2001 gegründete Buddhistische Akademie, ein Netzwerk für Menschen, die Buddhismus im europäisch-westlichen Kulturraum üben und weitergeben.