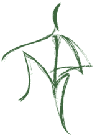Fragen zu Arbeit und Muße
Diese Fragen wurden 2005 im Anschluss an einen Vortrag von Sylvia Wetzel über Arbeit und Muße gestellt.
Wen Gott liebt, den straft er – Übung versus Gnade – Übung als Abwehr von Kontrollverlust? – Keine Lust zur Übung – Macht Muße von allein kontemplativ? – Muster auflösen – Gibt es zuviel Muße?
Was halten Sie von dem Satz: Wen Gott liebt, den straft er?
Antwort: Die erste Frage bezieht sich auf eine jüdische und christliche These: „Wen Gott liebt, den straft er, den prüft er.“ Das ist das Thema der Hiobsgeschichte. Dahinter steht die Haltung: Selber denken und Meditieren allein reicht nicht aus, um Muster zu verändern. Es braucht das Schicksal, das uns so richtig durchrüttelt, damit wir mit einem spirituellen Weg beginnen. Ohne existenzielle Erfahrungen fängt man nicht an: „Ach ja, jetzt meditiere ich mal ein bisschen.“, so funktioniert das nicht. Wenn ich die Menschen in meinen Kursen anschaue, gibt es vielleicht zehn Prozent, die sagen: „Ach, mein Leben ist so reich. Jetzt soll es noch reicher werden. Jetzt fange ich an zu meditieren.“ Das Gros sagt: „Ich komme aus einer Krise, es gab eine Trennung, eine Krankheit oder eine unangenehme Veränderung in der Arbeit. Ich bin jetzt vierzig geworden, ich bin jetzt fünfzig geworden.“
Zäsuren und Krisen sind Situationen, die uns auch unserer eingefahrenen Bahn schleudern. Deswegen sprechen wir von Krise. Es läuft nicht mehr wie geplant. Von daher ist eine Krise sicherlich ein wunderbarer Anstoß. Aber leider fangen nicht alle Leute, die in einer Krise stecken, an zu meditieren. Man muss Krisen nicht suchen. Das Leben bringt sie von alleine. Aber es gibt trotzdem ein paar Leute, die schon in jungen Jahren dieses existenzielle Fragen in sich tragen. Sie brauchen dann nur an die entsprechende Person oder in den entsprechenden Kontext zu geraten, ein Buch oder ein Gespräch, und dann wird, schnips, etwas ausgelöst. Das gibt es natürlich schon auch.
„Wen Gott liebt, den straft er.“ Die tibetische Entsprechung dafür wäre: „Wenn man in Retreats krank wird, ist das hervorragend, ein Hinweis auf tiefe Reinigung.“ Meine Haltung dazu ist: Wenn solche Thesen uns inspirieren und nicht demotivieren, sollten wir sie im Herzen bewegen. Dann kann man sie sich über das Bett hängen: „Durch Krisen reifen. Leid macht spirituell und reif.“ usw.
Inzwischen finde ich die Hiobsgeschichte gut. Früher fand ich sie furchtbar, einfach ungerecht. Dazu eine kleine Geschichte von Meister Eckhard. Er sagt, manche Leute wollen Gott sehen, wie sie ihre Kuh sehen. Und sie beten, damit sie Reichtum kriegen. Das hat nichts mit Gott zu tun. Sie lieben Gott wie eine Kuh, die Milch gibt und wärmt. Es ist natürlich klar, und die Religionen tragen mit dazu bei, dass sie sagen: „Meditiere mal schön, dann schaffst du gutes Karma, und dann wirst du Glück und Segen und alles mögliche ernten.“ Auf der anderen Seite braucht wir schon eine Karotte, die man uns Esel vor die Nase hält, damit wir in Gang kommen.
Meine eigene Antwort auf diese Frage lautet so: Ich habe den Eindruck, wenn man an den eigenen Lebensfragen dran bleibt, bleibt man auch am Ball. Für mich ist es das einfachste Mittel, um immer wieder inspiriert zu sein. Ich frage mich immer wieder: „Was ist mir wirklich wichtig?“ Und lese entsprechenden Texte, die genau dieses existentielle Fragen stärken.
Intensive Praxis versus Gnade?
Antwort: Eine These besagt, die Gnade Gottes ist für alle da. Das Konzept der Gnade ist wichtig in den theistischen Religionen, und es gibt das auch in manchen Schulen des Buddhismus. Sie bedeutet, dass man selber nichts tun kann. Ist eine Praxis mit vielen Übungen, die man ausführt, die man machen kann, nicht eine Flucht vor dem sich Öffnen, vor dem Erleben der Gnade? Ist intensive Praxis nicht auch Aktivität aus Angst vor Kontrollverlust? Da gibt es wieder eine Faustregel, die nicht genau stimmt, aber so ungefähr Geltung hat: Man braucht eine gewisse Art von Flexibilität des Geistes und des Körpers, von Herz und Geist, damit man überhaupt für Gnade empfänglich wird. Das heißt, Praxis kann die Gnade nicht herbeizwingen.
Auch Buddhisten sagen, selbst die intensivste Praxis kann die Einsicht in Buddhanatur, die Öffnung des Herzens, tiefes Verstehen, das Gefühl von Verbundenheit nicht erzwingen. Da kann man beten, rezitieren und meditieren bis einem die Ohren abfallen, man kann es nicht erzwingen. Genauso wenig kann man im Garten das Wachsen des Rucola und der Blumen erzwingen. Aber man kann den Boden vorbereiten. Dafür steht das Gleichnis vom Samenkorn. Man kann den Boden lockern, wässern, und man kann Samen hineinlegen. Samen entsprechen den heilsamen Gedanken. Man kann sehr viele Samen hineinlegen, aber nicht zu viele, sonst klumpt es.
Es gibt viele Leute mit spiritueller Verstopfung. Wirklich! Die haben so viele Praktiken im Kopf, dass sie zu nichts kommen. Wir Menschen aus dem Westen sind ziemlich prädestiniert dafür, weil wir so gierig sind. Wir sind so verloren und stopfen einfach alles in uns rein, was wir kriegen können: Texte, Praktiken, Bilder, Lehrer und Lehrerinnen, Kurse und noch einen Kurs und noch eine Technik. Und zum Schluss hat man spirituelle Verstopfung. Lama Yeshe hat zu uns gesagt: „Der Buddhismus ist ein Supermarkt. Aber wenn ihr in den Supermarkt geht, und da gibt es hundert Brotsorten, müsst ihr nicht alle Brotsorten kaufen und alle nacheinander essen. Ihr geht in den Supermarkt, überlegt euch, was ihr verkraftet, was ihr braucht, was euch nährt, und dann wählt ihr aus und kocht euer eigenes Mahl.“ Diese Empfehlung finde ich sehr hilfreich.
Praxis als Abwehr von Kontrollverlust?
Antwort: Das ist eine wichtige Frage. Man muss lernen, den Unterschied zu begreifen zwischen dem, was man mit etwas Mühe tun kann und was nicht, und zwar auf immer feineren Ebenen. Man kann sich mit etwas Mühe auf die Übung vorbereiten, den Körper in ein gute Verfassung bringen und innehalten. Man kann mit etwas Bemühen Bücher lesen, Übungen machen, sich mit anderen Leuten treffen. Man kann einen Kurs besuchen. Man kann üben. Aber das, worum es geht, ist ein Geschenk. Liebe, Verstehen, Verbundenheit, Kreativität, Inspiration, das kann man alles nicht machen. Ich kann ein bisschen besser begreifen lernen, dass ich mein Bestes tun kann, das Buch heute lesen, den Text rezitieren oder vierzehn Tage lang zehn Minuten am Tag die Übung „Mögen alle Wesen glücklich sein!“ machen, aber bestimmen, wann mein Herz aufgeht, kann ich nicht.
Ich kann mit der Zeit immer tiefer begreifen, dass man das Wesentliche nicht machen kann. Warum nicht? Weil es schon da ist! Wir stehen uns nur im Weg herum. Praxis hilft uns zu erkennen, wo wir uns selber im Weg herumstehen. Eigentlich bedeutet Praxis, ein spiritueller Weg, die Hindernisse, die Schleier, die vor unseren Augen hängen und die Blockaden zu erkennen. Wir machen nichts Neues. Die Liebe muss man nicht machen. Das Verstehen, die Verbundenheit muss man nicht machen, es ist alles da. Es geht nur darum, die Hindernisse zu erkennen. Wer schon einmal im Garten gearbeitet hat weiß das. Es ist ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich, weil man soviel Geschenke bekommt.
Frage: Was macht man, wenn man keine Lust hat, zu meditieren? Soll man sich dazu zwingen?
Antwort: Bei mir funktioniert Zwang nicht. Da werde ich sofort rebellisch. Das geht einfach nicht. Ich bin sehr dankbar, dass mein wichtigster tibetischer Lehrer, Lama Yeshe, immer gesagt hat: „Sucht euch die Übung, die euch gefällt. Ihr müsst nicht die schwierigste, komplizierteste Übung, die ihr am doofsten findet, machen, weil ihr denkt, es ist spirituell heilsam, das Ego an die Kandare zu nehmen.“ Wenn ihr gerne singt, dann singt. Wenn ihr gerne Gedichte lest, dann lest Gedichte. Ich spreche inzwischen nicht mehr von regelmäßig Meditieren sondern von Innehalten und Auszeiten. Wenn ihr eine halbe Stunde auf eurem Bänkchen auf dem Balkon sitzt, in den nächsten Park geht und einfach nur sitzt und Flöte spielt oder in die Luft guckt, ist das gut. Einmal am Tag innehalten in diesem zwanghaften Trott, dauernd etwas tun zu müssen, reicht völlig aus, für den Anfang.
Wenn man eher unter mangelnder Energie leidet, sollte man sich eine Struktur geben, die uns hilft, in Schwung zu kommen. Die Faustregel ist immer: Wenn uns die Muster überwältigen, ob das Gier, Abwehr, Trägheit oder Hektik ist, brauchen wir Strukturen, die diese Muster zumindest einmal zeitweilig neutralisieren. Es ist egal, ob man zu wenig oder zu viel tut, man braucht eine Struktur, wenn man im Griff dieser Muster ist. Und das ist die Funktion regelmäßiger Übung. Es geht nicht darum, dass man die objektiv beste Methode übt. Die gibt es nicht. Es gibt nur die Methode, die jetzt im Augenblick, in dieser Lebensphase für uns funktioniert. Meistens gibt es mehrere, die funktionieren.
Ich würde sagen, wenn man keine Lust hat zu meditieren, sollte man sich einfach hinsetzen und sich nichts vornehmen. Vielleicht noch ein Tipp, auch wieder von Lama Yeshe. Wenn du keine Lust hast zu meditieren, dann setze dich wenigstens hin, so dass dein Körper meditiert, selbst wenn dein Geist im Viereck springt. Und ein weiterer Tipp: Wenn ihr merkt, ihr könnt überhaupt nicht meditieren, dann macht auch nichts anderes in dieser halben Stunde. Sonst ist die Lücke gleich voll mit Zeitung lesen, Schlafen oder Fernsehen gucken. Reserviert euch einen Teil des Tages fürs Innehalten, und was ihr da macht, ist relativ sekundär. Aber lasst nichts anderes zu in der Zeit.
Ihr müsst nicht jeden Tag üben. Ich habe immer den Sabbat heilig gehalten, auch beim Meditieren. Man muss nicht jeden Tag meditieren, fünf, sechs Mal die Woche reicht. Dann kriege ich keinen Stress. Eine Frau, die bei mir meditiert, hat einmal gesagt: „Wenn ich überhaupt keine Lust habe zu meditieren, dann sage ich zu mir: ´Gut, du brauchst heute nicht meditieren. Aber dann darfst du morgen und übermorgen auch nicht meditieren!´“ Das hat bei ihr sehr gut funktioniert. Man nennt das paradoxe Intervention. Bei mir funktioniert das auch gut, nach dem Motto: „Ich lass mir doch nicht vorschreiben, dass ich morgen nicht meditieren darf. Da meditiere ich lieber heute!“ Und ein bisschen solala meditieren ist besser als gar nicht.
Eines kann ich Ihnen und Euch allen garantieren: Es ist nicht die Qualität der einzelnen Übung, die die Veränderung bringt, sondern die Kontinuität. Man kann wochenlang so ein bisschen nuschelig meditieren, irgendwann wird man ein bisschen klarer. Allerdings braucht es dazu auch Inspiration. Und das ist etwas, was man nicht machen kann. Das Einzige, was da hilft, sind Menschen. Nur die emotionale und geistige Ansteckung durch Menschen setzen etwas in Bewegung oder berühren etwas, das da ist.
Wenn man sich Muße gibt, kommt dann die kontemplative Haltung von alleine? Ändert sich das Leben dann von alleine?
Antwort: Das würde ich für eher aktive Menschen auf jeden Fall betonen. Da es beides gibt, das Aktive und das Kontemplative, müssen wir eine für uns stimmige Balance finden. Wenn man eher zur Trägheit neigt, muss man dreimal am Tag spazieren gehen oder sich eine Struktur bauen, um dem Muster der Trägheit entgegenzuwirken. Für die meisten Workoholics gilt: Sobald Raum da ist, werden wir intelligenter, liebenswürdiger, kreativer, und wir sind wir inspirierter. Allerdings braucht es auch existentielle Fragen. Einfach Freizeit, ohne Fragen, macht eher träge. Aber aktive Menschen haben eigentlich oft Fragen. Sie müssen sich nur den Raum dafür geben. Ein Lama hat einmal gesagt: Wenn es unerwachten Menschen zu gut geht, stellen sie etwas an und schaffen sich selber Problem, damit wieder was los ist.
Wie durchbreche ich, wenn ich mir Muße verordne, in dieser Zeit meine Muster?
Antwort: Muster kann man nur erkennen, auflösen werden sie sich von alleine. Eigentlich lösen sich viele Muster überhaupt nicht auf, aber sie haben nicht mehr diese Betonqualität. Sie werden eher wie Gummibärchen. Aber sie sind noch da. Ich sage manchmal, Muster sind wie Haken. Am Anfang sind es Stahlbetonhaken, und die andern haben natürlich auch Haken, und dann gibt es dauernd Konflikte, weil wir uns verhaken. Durch die Praxis werden diese Haken weicher, flexibler, Gummihaken. Zum einen muss man sich dann nicht mehr überall einhaken, und wenn es geschieht, ist es nicht so ein Drama. Von außen sieht es gleich aus. Extravertierte Die Menschen werden nicht plötzlich ganz introvertiert. Der Grundcharakter verändert sich nicht, nach meiner Beobachtung.
Mit der Zeit, wenn man den lebendigen Raum, in dem alles geschieht, das Unfassbare, das Größere, die Buddhanatur mehr zur Kenntnis nimmt und darauf vertraut, dass man daraus lebt, hält man sich nicht nur für das, was jetzt gerade passiert: „Ich bin diejenige, die jetzt was vergessen hat, das ist ja furchtbar!“ Sondern: „Dann habe ich eben etwas vergessen. Das ist danebengegangen, es tut mir leid! So what!“ Es ist nicht mehr so ein Drama. In dem Sinne ähnelt die Haltung der einer weisen alten Oma: „Ja mei, Kind, das geht vorbei!“
Gibt es zuviel Muße?
Antwort: Wenn Menschen keine Arbeit haben, haben sie sehr viel freie und oft unstrukturierte Zeit. Dann muss man sich eine Struktur schaffen. Es ist wichtig, dass man irgendetwas tut, wo man die eigenen Fähigkeiten anderen Leuten zur Verfügung stellt. Denen, die zu mir kommen und sagen: „Ich bin arbeitslos. Ich kann aus Krankheitsgründen nicht mehr arbeiten.“, rate ich:“Suche dir eine leichte, ehrenamtliche Tätigkeit, wo du gebraucht wirst, wo du Kontinuität in der Begegnung erlebst, wo du eine Rolle spielen kannst, damit du nicht immer deiner privaten Soße ausgeliefert bist.“
Wenn man mit anderen zusammen ist, muss man sich ein bisschen zusammennehmen und kann nicht jede Stimmung ausagieren. Das geschieht eher, wenn der Tag keine Struktur hat. Durch ehrenamtliches Tun hat man regelmäßige Begegnungen mit Menschen, wird mit seinen Qualitäten gefordert und kann sich einbringen. Dann fühlt man sich nicht überflüssig. Ich glaube, wir brauchen alle das Gefühl gebraucht zu werden. Sich zu zeigen, etwas zu tun, sich einzubringen ist keine Neurose sondern ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Vielleicht reichen zwei Tage oder fünf Stunden in der Woche, es muss nicht unendlich viel sein, einfach so, wie es möglich ist. Kontinuität und Regelmäßigkeit helfen dabei sehr viel. Also nicht: „Ach, wenn ich Lust habe, dann geh ich mal beim Altenheim vorbei und guck mal.“, sondern jeden Donnerstag Nachmittag zwei Stunden. Dadurch wird es für beide Seiten zu einem Fixpunkt, und das stabilisiert. Struktur, Kontinuität und Verbindlichkeit stabilisieren.
Irgendwann muss man begreifen: Wir wollen Freiheit, aber wir brauchen auch Geborgenheit. Wir brauchen beides, wir Menschen sind paradoxe Wesen. Wenn man für das eine Partei ergreift und die andere abschneidet, landet man im Graben. Wirklich, wir brauchen beides! Und die Balance ist natürlich individuell. Die eine Person braucht mehr Freiheit, ein bisschen weniger Geborgenheit, mehr oder weniger Leute. Aber wir brauchen beides.
Ich begleite schon lange Menschen auf dem spirituellen Weg. Meine Beobachtung ist, wenn man einmal kapiert, wie sehr man auf den Kontakt, die Begegnung, die Kontinuität mit anderen Menschen angewiesen ist, fällt es viel leichter, die eigenen Bedürfnisse auch einmal zurückzustellen: „Ich hätte jetzt aber lieber frei heute. Ich würde mich aber lieber selber entfalten.“ Die Haltung kommt dann weniger vor. Irgendwann kapiert man, das ist zwar wichtig und braucht Raum, aber ich kann auch zurückstecken. Was ich an Unterstützung durch diese kontinuierlichen Beziehungen bekomme, ist unendlich viel mehr wert, als jeden Tag selber entscheiden zu können, was ich von morgens bis abends mache.
Arbeit und Muße. Fragen zum Vortrag am 23. Juni 2005 im Rahmen der Buddhistischen Akademie im Berliner Yoga Zentrum in Schöneberg.
Die Abschrift hat Uta da Silva geleistet. Der Text wurde von Renate Bleis redigiert. Und nun zu Allerheiligen 2007 kann er hier erscheinen.